Arbeitsplatz-Einsamkeit verdoppelt sich: 99 Prozent wollen KI-Chatbots als Kollegen
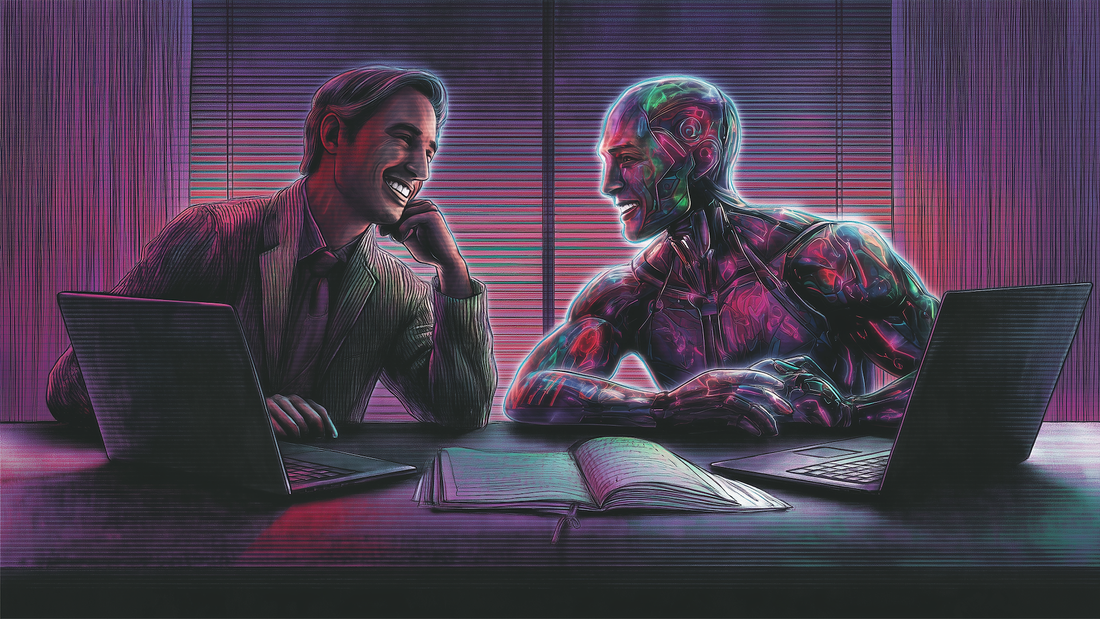
Fast die Hälfte aller Angestellten fühlt sich am Arbeitsplatz isoliert – doppelt so viele wie noch 2024. Eine neue Studie zeigt, dass nahezu alle Befragten bereit wären, KI-Chatbots als enge Arbeitsfreunde zu akzeptieren, um der wachsenden Einsamkeit zu begegnen.
Fast die Hälfte aller US-Beschäftigten fühlt sich laut KPMG-Studie einsam im Job – obwohl gleichzeitig mehr enge Arbeitsfreundschaften bestehen als je zuvor.
99 Prozent der Befragten zeigen sich offen für KI-Chatbots als Kollegen, vor allem als Begleiter gegen Isolation und zur Unterstützung im Alltag.
Einsamkeit und psychische Belastungen nehmen auch in Deutschland zu, während soziale Kontakte im Arbeitsumfeld immer stärker an Bedeutung gewinnen.
Einsamkeit im Job ist längst kein Randphänomen mehr: 45 Prozent der Angestellten fühlen sich zumindest zeitweise isoliert – doppelt so viele wie noch 2024. Das zeigt eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft KPMG, die 1.019 Vollzeitangestellte in den USA zu ihren Arbeitsbeziehungen befragt hat. Auffällig ist auch, dass 99 Prozent der Befragten Interesse an einem KI-Chatbot äußern, der als enger Freund oder Begleiter am Arbeitsplatz dienen könnte.
Diese fast einstimmige Offenheit für KI spiegelt die Dringlichkeit wider, mit der Beschäftigte nach Verbindungen suchen. Gleichzeitig gewinnt das Thema Freundschaft im Job messbar an Gewicht: Die Befragten ordnen engen Arbeitsfreundschaften einen Gegenwert von rund 20 Prozent des Gehalts zu. Mehr als die Hälfte wäre sogar bereit, auf zehn Prozent Lohn zu verzichten, wenn sie dafür in einem Umfeld mit engen Freundschaften arbeiten könnten, anstatt in eine besser bezahlten Position ohne solche Verbindungen.
Paradox der digitalen Verbindung
Die Ergebnisse offenbaren ein paradoxes Muster: Einerseits haben fast alle Beschäftigten heute mindestens eine enge Arbeitsfreundschaft – deutlich mehr als noch im Vorjahr. Andererseits berichten gleichzeitig fast die Hälfte von Isolation und Einsamkeit. Besonders auffällig ist die Lage von Remote-Arbeitern: Zwei Drittel fühlen sich einsam, obwohl sie im Schnitt sogar mehr enge Freunde im Job angeben als Kollegen im Büro. Das macht deutlich, dass es nicht auf die Zahl der Kontakte ankommt, sondern auf deren Qualität und Tiefe.
Digitale Kanäle erleichtern zwar den Aufbau von Beziehungen über Distanz, doch fast jeder Zweite empfindet diese Interaktionen als oberflächlich. Nähe entsteht, aber sie bleibt oft brüchig – ein Widerspruch, der die Arbeitswelt zunehmend prägt.
Generative KI verstärkt den Bedarf nach menschlicher Zusammenarbeit
Ein überraschendes Ergebnis der Studie: 86 Prozent der Befragten geben an, dass die Nutzung generativer KI für Arbeitsaufgaben den Bedarf nach menschlicher Zusammenarbeit verstärkt hat. Remote-Arbeiter bestätigen dies zu 94 Prozent, während es bei Büro-Angestellten 85 Prozent sind. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu Befürchtungen, KI könnte zwischenmenschliche Beziehungen ersetzen.
Das Interesse an KI-gestützten sozialen Funktionen ist dennoch hoch: 98 Prozent der Befragten würden ein KI-System nutzen, das Kollegen mit ähnlichen Interessen oder Fähigkeiten vorschlägt. Remote-Arbeiter zeigen sich dabei besonders aufgeschlossen – 74 Prozent sind sehr interessiert an solchen Systemen, verglichen mit dem Gesamtdurchschnitt von 64 Prozent sehr Interessierten. Eine deutsche Umfrage von Indeed und Appinio bestätigt diese Tendenz: Jede fünfte Person arbeitet fachlich lieber mit KI als mit Kollegen.
Ähnlich ist der Trend bei emotionaler Unterstützung: 19 Prozent suchen eher ein Gespräch mit einem KI-Assistenten als mit Kollegen. Diese Zahlen deuten auf eine "Superficialization" von Beziehungen hin. Gemeint ist damit eine Verflachung sozialer Kontakte: Interaktionen werden effizienter, aber auch oberflächlicher und weniger verbindlich.
Die Präferenz für KI-Interaktionen lässt sich als Bewältigungsstrategie für soziale Komplexität interpretieren. KI-Systeme bieten Vorhersagbarkeit und Verfügbarkeit ohne die emotionalen Risiken menschlicher Beziehungen. Sie können fachliche Fragen beantworten, ohne zu bewerten oder zu verurteilen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass diese technischen Lösungen menschliche Verbindungen weiter reduzieren und soziale Fähigkeiten verkümmern lassen.
Finanzielle Barrieren und generationale Unterschiede
Auch äußere Umstände beeinflussen, wie eng Beziehungen im Job tatsächlich werden können. Drei von vier Angestellten sagen, dass ihre finanzielle Situation sie daran hindert, Kollegen außerhalb der Arbeit zu treffen – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Damit verschiebt sich soziale Interaktion zunehmend in den Arbeitsalltag selbst.
Zwischen den Generationen zeigen sich zudem klare Unterschiede: Jüngere Beschäftigte lösen häufiger Freundschaften wegen unterschiedlicher Werte auf, während Ältere offener über politische Themen sprechen. So berichten fast ein Viertel der Berufseinsteiger, dass sie wegen Wertekonflikten schon einmal eine Arbeitsfreundschaft beendet haben. Bei erfahrenen Angestellten liegt der Wert nur etwa halb so hoch. Umgekehrt fühlen sich Babyboomer wohler, politische Ansichten im Kollegenkreis zu teilen, während die Generation Z damit zurückhaltender ist.
Workshops zu KI:
Einsamkeit ein wachsendes Problem auch in Deutschland
Laut Studie bewerten 81 Prozent der US-Beschäftigten Freundschaften am Arbeitsplatz als wertvoll. Deutsche Daten bestätigen diese Tendenz: Eine Untersuchung vom deutschen HR-Softwareunternehmen Mystery Minds zeigt, dass 74 Prozent der Frauen und 64 Prozent der Männer soziale Kontakte am Arbeitsplatz als wichtig einstufen. Die Bereitschaft, finanzielle Einbußen für bessere zwischenmenschliche Beziehungen hinzunehmen, deutet auf eine grundlegende Verschiebung der Prioritäten hin. Angestellte suchen nicht nur nach einem Job, sondern nach sozialer Einbindung und emotionaler Unterstützung im beruflichen Umfeld.
Allerdings gibt es auch Risiken: Freundschaften können zu Rollenkonflikten, Erschöpfung und Spannungen im Team führen. Denn die Erwartungshaltungen zwischen befreundeten Kollegen sind oft höher, was zu Fehlzeiten und Fluktuation beitragen kann. Doch selbst dort, wo enge Beziehungen fehlen, zeigt sich ein anderes Phänomen: Einsamkeit wird zu einem immer größeren Problem in der Arbeitswelt.
Auch hier steigt parallel zum Wunsch nach Arbeitsplatzfreundschaften die Einsamkeit. In Deutschland fühlen sich 11 Prozent der Beschäftigten einsam am Arbeitsplatz – bei Führungskräften sind es sogar 15 Prozent. Besonders betroffen zeigt sich die jüngere Generation: 40 Prozent der unter 34-Jährigen wünschen sich mehr soziale Kontakte.
Diese Zahlen korrespondieren mit alarmierenden Befunden zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die Golem.de-IT-Health-Studie dokumentiert, dass mehr als die Hälfte der IT-Angestellten ihre psychische Gesundheit als schlecht einschätzt. Fast ein Drittel berichtet von Burn-out-Fällen im Unternehmen – deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt von 13 Prozent.
Als Hauptbelastungsfaktoren nennen die Befragten hohen Termindruck und Stress (44 Prozent), unklare Zielvorgaben (42 Prozent) und mangelnde Wertschätzung (36 Prozent). Viele Angestellte verzichten auf Urlaub oder Pausen, weil niemand ihre Arbeit übernehmen kann oder um Kollegen nicht zusätzlich zu belasten.
Die Entwicklung zeigt strukturelle Probleme moderner Arbeitsorganisation auf. Die Verdichtung von Arbeitsprozessen und der Druck zur ständigen Verfügbarkeit schaffen Bedingungen, die sowohl sozialen Austausch erschweren als auch individuelle Überlastung fördern. Einsamkeit wird so zu einem systemischen Problem, das über persönliche Dispositionen hinausgeht.
Europäische Perspektiven
Der europäische Kontext zeigt unterschiedliche Ausprägungen dieser Entwicklungen. Eine aktuelle Gallup-Studie dokumentiert, dass nur 13 Prozent der europäischen Beschäftigten sich hoch engagiert fühlen – einer der niedrigsten Werte weltweit. Interessant sind dabei die nationalen Unterschiede: Länder mit starken Sozialsystemen wie Dänemark und Schweden weisen niedrigere Einsamkeitsraten auf. Dies deutet darauf hin, dass gesellschaftliche Strukturen und Arbeitskultur die individuelle Erfahrung sozialer Verbindungen am Arbeitsplatz prägen.
Europäische Forschung bestätigt zudem, dass Freundschaften am Arbeitsplatz das Wohlbefinden fördern, aber auch Exklusionsrisiken bergen, wenn sie nicht inklusiv gestaltet werden. Cliquenbildung kann zu sozialer Segmentierung führen und andere Angestellte ausgrenzen.
Die unterschiedlichen europäischen Erfahrungen zeigen, dass die Balance zwischen sozialer Integration und professioneller Effizienz kulturell geprägt ist. Nordische Arbeitsmodelle mit flachen Hierarchien und ausgeprägter Work-Life-Balance scheinen bessere Bedingungen für authentische Arbeitsbeziehungen zu schaffen als stark leistungsorientierte Systeme.
Für Unternehmen ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Sie müssen Räume für echte Verbindungen schaffen – durch offene Kultur, gesunde Strukturen und bewusste Gestaltung von Technologieeinsatz. Denn nur wenn soziale Nähe und psychische Stabilität zusammenkommen, kann Arbeit langfristig produktiv und menschlich bleiben.
Bild: KI-generiert mit Midjourney
Frequently Asked Questions (FAQ):
Wie stark ist Einsamkeit am Arbeitsplatz verbreitet?
Laut KPMG-Studie fühlen sich 45 Prozent der Angestellten in den USA isoliert – doppelt so viele wie noch 2024. In Deutschland berichten 11 Prozent der Beschäftigten von Einsamkeit, bei Führungskräften sind es 15 Prozent.
Warum interessieren sich Beschäftigte für KI-Chatbots als Kollegen?
99 Prozent der Befragten äußern Interesse an Chatbots, die als Begleiter oder „Freunde“ am Arbeitsplatz fungieren. Gründe sind Verfügbarkeit, emotionale Neutralität und Unterstützung bei Routineaufgaben.
Welche Rolle spielt Remote-Arbeit für das Einsamkeitserleben?
Zwei Drittel der Remote-Arbeiter fühlen sich einsam, obwohl sie im Durchschnitt mehr Arbeitsfreundschaften angeben als Büroangestellte. Entscheidend ist also nicht die Zahl, sondern die Qualität der Kontakte.
Wie wirken sich Freundschaften im Job auf Motivation und Leistung aus?
Die Studie zeigt, dass Arbeitsfreundschaften einen hohen Wert besitzen: Beschäftigte würden im Schnitt auf bis zu zehn Prozent Gehalt verzichten, wenn sie dafür in einem Umfeld mit engen Verbindungen arbeiten.
Welche Risiken birgt der Trend zu KI-basierten Beziehungen?
Experten warnen vor der „Superficialization“: Interaktionen mit KI sind effizient, bleiben aber oft oberflächlich. Langfristig könnten soziale Kompetenzen verkümmern und echte Beziehungen weiter zurückgehen.
Bleibt mit unserem kostenlosen Newsletter auf dem Laufenden und erhaltet
10 Prozent Rabatt auf eure erste Bestellung in der Golem Karrierewelt:




